Ende Mai 2014 machte eine schockierende Nachricht Schlagzeilen in den USA: Zwei zwölfjährige Mädchen stachen mehrfach auf ihre Mitschülerin mit einem Küchenmesser ein. Das Motiv: Sie wollten dem „Slender Man“, einer populären Gruselgestalt aus dem Internet, imponieren.
Anissa Weier und Morgan Geyser aus Wisconsin, USA, hatten den Mord an ihrer Klassenkameradin schon monatelang vorher geplant. Nachdem sie das Mädchen in einen Wald brachten, stachen sie auf das Opfer ein und ließen es anschließend an Ort und Stelle zurück. Die Verletzte konnte sich noch mit letzter Kraft zur Straße hieven und Hilfe holen. Sie überlebte knapp. Gegenüber der Polizei gaben die zwei Täterinnen an, sie hätten sich von einem Internetphänomen inspirieren lassen. Eine Figur namens Slender Man habe sie dazu gedrängt, einen Mord zu begehen.
Wer oder was ist der Slender Man?
Bei der fiktiven Internetfigur des Slender Man (dt.: „Der schlanke Mann“) handelt es sich um eine ausgedachte Gruselgestalt, deren Geschichte in Internetforen weitererzählt wurde und sich schließlich verselbständigte. Über sein Aussehen und seine Taten existieren die unterschiedlichsten Versionen und Theorien, wie es in dem Fan-Forum auf www.slenderman.de heißt. Im Großen und Ganzen wird der Slender Man jedoch meist als unnatürlich dünne geistähnliche Gestalt ohne Gesichtszüge dargestellt. Dazu trägt er einen dunklen Anzug, Hemd und Krawatte. War er in den ersten Versionen noch unsichtbar, ist er in den späteren Interpretationen deutlich körperlich wahrnehmbar. In manchen Geschichten trägt er zudem schwarze Tentakel auf seinem Rücken. Über die genauen Machenschaften und Absichten des Slender Man scheiden sich die Geister und Versionen der Fans. In einer der letzten Theorien erzählt man sich jedoch, dass der hünenhafte Mann für das Verschwinden von Kindern verantwortlich sein soll. Er sei außerdem in der Lage, Menschen in seiner Nähe in den Wahnsinn zu treiben und sie zu beeinflussen.
Angefangen hat alles als kreativer Internetstreich im Juni 2009. Damals nahm der US-Amerikaner Eric Knudsen bei einem Foto-Wettbewerb der Gruselwebsite www.somethingawful.com teil. Für das Motto „Paranormale Bilder“ sollten die Teilnehmer*innen gewöhnliche Fotos digital bearbeiten, in dem sie z.B. Geister einfügten. Dazu dachten sich die User*innen anschließend spannende und gruselige Geschichten aus. Knudsen stellte zwei manipulierte Bilder ein, auf denen jeweils eine Gruppe von Kindern zu sehen war. Im Hintergrund ist eine unnatürlich große, hagere Gestalt abgebildet: der Slender Man.
Verrücktes Eigenleben eines Internetphänomens
Die Geschichte über den Slender Man verbreitete sich verblüffend schnell in den Internetforen: Fans teilten die Schauerstory und produzierten eigene Videos, Bilder oder neue Geschichten über den schlanken Gruselmann auf Webseiten wie z.B. www.creepypasta.com. Aus dem Mythos wurde eine bekannte Legende im Bereich der Horror-Fanfiction, die inzwischen wohl auf eine weltweite Fangemeinde blicken kann.
Das Eigenleben des Mems ging sogar noch weiter: Inzwischen gibt es eine eigene YouTube-Webserie über den Slender Man, einige Horrorvideospiele sowie einen Dokumentarfilm von HBO (2016) über den Mordversuch der beiden Mädchen aus Wisconsin. Sogar Hollywood widmete sich dem fiktiven Horrorwesen und produzierte einen Kinofilm, der dieses Jahr noch in die Kinos kommen soll.
Kontrovers diskutiert: Der Kinofilm zum Slender Man
In dem von Sylvain White inszenierten Horrorfilm „Slender Man“ geht es um vier junge Schülerinnen, die in einer Kleinstadt in Massachusetts leben und die Legende des schlanken Geistermannes genauer untersuchen wollen. Als sie dazu ein Ritual ausführen, verschwindet plötzlich eines der Mädchen. Die drei Verbliebenen müssen sich nun der Tatsache stellen, dass an dem Mythos wohl mehr dran ist, als es zunächst den Anschein machte.
Der Trailer des Gruselstreifens kam bereits im Januar dieses Jahres heraus. Der Kinostart war ursprünglich für den 17. Mai 2018 angesetzt, wurde nun jedoch auf September 2018 verschoben. In den USA löste das Projekt eine Debatte über die moralisch fragwürdigen Absichten der Filmemacher*innen aus. Insbesondere die Produktionsfirma Sony geriet dabei in die Kritik, die Tragödie verharmlosen und daraus auch noch Profit schlagen zu wollen. Bill Weier, der Vater von Anissa Weier, kritisierte das Filmstudio scharf und meinte gegenüber US-amerikanischen Medien:
„It’s absurd they want to make a movie like this. It’s popularizing a tragedy is what it’s doing. I’m not surprised, but in my opinion it’s extremely distasteful. All we’re doing is extending the pain all three of these families have gone through.“ Bill Weier, The Hollywood Reporter
Die Frage nach dem Warum?
Was genau führt dazu, dass sich vor allem Jugendliche von einer fiktiven Horrorfigur beeinflussen lassen? Beim Slender Man verschwinden die Grenzen zwischen realer und ausgedachter Welt. Die bearbeiteten Fotos wurden nicht nur nahezu professionell manipuliert, auch die Hintergrundstorys erscheinen auf den ersten Blick plausibel. Mythen über sogenannte „Kinderschreckfiguren“, die Kindern Angst machen und für das Verschwinden von eben diesen verantwortlich sein sollen, gab es schon in den früheren Jahrhunderten. Aber reicht das aus, um Teenager etwas so Böses wie den Mordversuch an einer Mitschülerin planen zu lassen? Ist der Slender Man tatsächlich so überzeugend?
Warum die beiden Schülerinnen aus Wisconsin letztendlich diese grausame Tat begangen haben, bleibt wohl weiterhin unklar. Allerdings, so die Journalistin Katy Waldman, sei es einfacher, einer Horrorfigur wie dem Slender Man die Schuld an solch einem tragischen Ereignis zu geben, als sich mit der eigentlichen Frage auseinanderzusetzen, warum zwei bis dahin unschuldige Mädchen zu so einem Verbrechen fähig sind.














 Foto: Stephanie Constantin
Foto: Stephanie Constantin





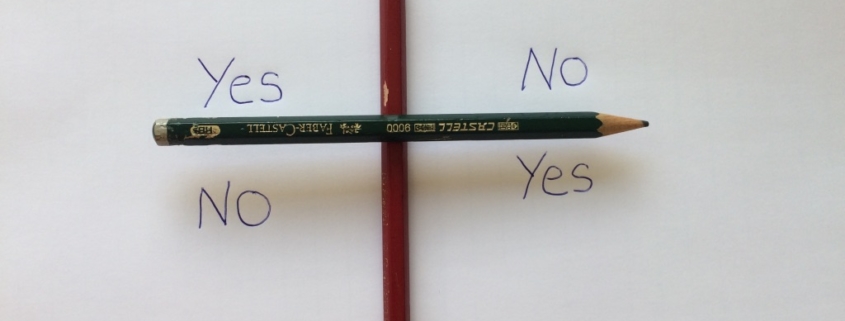

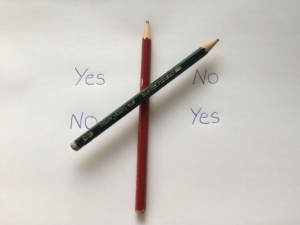
 pisxybay edited
pisxybay edited





 Pinterest: static.panoramio
Pinterest: static.panoramio



