Sagenumwoben, gefürchtet und von einer unbändigen Faszination umgeben: Der Berg der Berge, der Mount Everest. Unsere Redakteurin erzählt von eigenen Erfahrungen am Fuße des höchsten Berges der Welt, welche Wirkung die Kultur auf Tourist*innen ausübt und warum der höchste Berg der Erde zugleich heilig und unheimlich ist.

Die Feengöttin Jomo Miyo Lang Sangma lebt auf dem Mount Everest. (Quelle: http://www.flars.net/centromaria/nepal.htm)
Wenn etwas das Schönste, das Schlimmste oder in diesem Fall das Höchste ist, wird darum herum ein Gespinst aus Sagen und Geschichten gesponnen, das den materiellen Wert noch einmal steigert. So ist das auch mit dem höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest. Sagarmatha in der Sprache der Nepali (= Himmelskönig), Qomolangma in der Sprache der Tibeter (= Göttin-Mutter der Erde). Schon bevor der Nepalese Tensing Norgay und der Brite Edmund Hillary am 29. Mai 1953 als erste Menschen den Gipfel erreichten, war der Berg in Nepal und Tibet in aller Munde. In der buddhistischen Kultur der Sherpas bewohnen Geister und Dämonen die Gipfel der Berge. Demnach wohnt auf dem Mount Everest Jomo Miyo Lang Sangma, eine der fünf „Schwestern des langen Lebens“, die auf den fünf höchsten Gipfeln des Himalaya wohnen. Jomo Miyo Lang Sangma bringt den Menschen Nahrungsmittel. Sie ist die drittjüngste von fünf Feengöttinnen. Einer Sage nach lieferten sich um 1300 Padmasambhava (der Mann, der den Buddhismus nach Nepal brachte) und der Lama der Bön-Religion (im 8. Jahrhundert die vorherrschende Religion in Tibet) ein Wettrennen hinauf zu der Feengöttin auf den Berg. Der Lama wurde von seiner magischen Trommel getragen und Padmasambhava von einem Lichtstrahl. Der Lichtstrahl war schneller. Der Lama ließ deshalb enttäuscht seine Trommel am Gipfel zurück.
„Noch heute sagen die Sherpas, dass Geister die Trommel schlagen würden, wenn eine Lawine den Berg hinunterdonnert.“ – Basler Zeitung
Die Menschen in den Bergdörfern des Himalayas sind besonders gläubig, denn ihr Leben hängt von der Gnade der Berggötter ab. Das Wetter wechselt in Sekundenschnelle, Lawinen gehen ab, Erdbeben zerstören ganze Landstriche.
Ein Erfahrungsbericht aus dem Sagarmatha Nationalpark

Im Hintergrund blitzt eine winzige Spitze des Mount Everests hinter der Bergkette auf. (Quelle: L. Haas)
Als ich 2015 zum ersten Mal eine winzige Spitze des höchsten Berges der Welt erblickte, fühlte es sich an, als würde dieser runde Planet aufhören sich zu drehen. Ein winziges Stück Berg hinter dem Lhotse und dem Nuptse, den beiden Bergen, die den Berg der Berge umgeben. Eine weiße Rauchfahne scheint von der Spitze aufzusteigen. „Der Berg raucht“, erklärt mir Sune Tamang, unser Bergführer mit seinem gewohnt verschmitzten Lächeln. Von etwa 4.000 Metern Höhe kann ich nur erahnen, wie stark der Wind dort oben auf 8.848 Metern pustet und diese weiße Fahne auslöst. Einige Tage später, vom Gipfel des Aussichtsberges Kala Patthar aus blicke ich von läppischen 5.555 Metern hinauf zum noch immer unerreichbaren Dach der Welt. Ich kämpfe mit der Anstrengung des Aufstiegs. Alle paar Schritte muss ich anhalten und wegen des kaum vorhandenen Sauerstoffs schon auf dieser Höhe wie ein Walross schnaufen. Keine halbe Stunde bleiben wir dort, schon geht es wieder hinunter ins Dorf auf 5.100 Meter, um die Höhenkrankheit zu vermeiden. Ich frage mich, wie könnte ich jemals auf den Mount Everest steigen, wenn mir hier schon die Puste ausgeht?
Kommerz auf dem Dach der Welt
Viele andere Bergsteiger*innen stellen sich diese Frage nicht. Der Berg übt eine Faszination aus, die ihresgleichen sucht. Einmal am höchsten Punkt der Erde sein, dem Himmel so nah wie nie zuvor. Das ist der Wunsch hunderter Bergsteiger*innen, die jedes Jahr nach Nepal oder Tibet kommen und den Aufstieg wagen wollen. Und manche von ihnen kehren nie wieder heim. Denn der höchste Berg der Welt fordert Opfer. Über 200 Menschen sind bereits oben am Berg gestorben. Viele haben nicht die Kondition oder die technische Erfahrung, die ein solcher Aufstieg erfordert. Sie haben aber das Geld und kaufen sich ihren Weg auf den Berg. Über 60.000 Dollar kostet es, auf den Mount Everest zu steigen. Für das Permit (die Aufstiegsbescheinigung) verlangen die Nepali so viel Geld, weil ihnen der Berg heilig ist. Am liebsten sollte niemand hinaufsteigen, doch so ist er immerhin eine gute Einnahmequelle. Wer den Aufstieg oder den Weg hinunter nicht überlebt, bleibt wohl für immer dort oben. Eine Bergung ist zu riskant – und so ist der Weg nach oben von Leichen gesäumt. Auch diese Geister leben vermutlich am Berg weiter und sind Teil seiner Geschichte.

Auf dem Mount Everest Basecamp-Trek: schon aus der Ferne sieht man die Spitze hervorblicken. (Quelle: L. Haas)
Der Traum eines jeden Bergsteigers
Als Bergtourist in Nepal bekommt man einiges von der Kultur mit, die durch ein friedliches Zusammenleben von Buddhismus und Hinduismus geprägt ist. Beim Aufbruch zum Bergaufstieg wird Reis ins Feuer geworfen und die Bergsteiger mit dem buddhistischen Mantra „Om mani padme hum“ verabschiedet. Mit diesem Mantra in Sanskrit wird Mitgefühl ausgedrückt. Trotzdem blieb auch für mich diese umfangreich gelebte Kultur ein bisschen hinter dem Massentourismus zurück. Als wir im Basislager des Mount Everest ankamen, wurde für mich ein Traum wahr. Einmal dort zu sein, wo die großen Bergsteiger gestartet sind. Der Berg ist einerseits so nah und doch so fern, denn von hier sind es noch immer über 3.000 Meter Aufstieg bis zum Gipfel. Dort oben warten Gefahren wie Wetterumschwünge, Sauerstoffmangel und die eigene körperliche und geistige Belastungsgrenze. In der Todeszone über 7.000 Meter darf man sich nicht lange aufhalten, denn dort beginnt man irgendwann zu halluzinieren, wenn die Höhenkrankheit eintritt. Es ist ein magischer Ort für die Einheimischen, aber auch für jeden Bergsteiger. Die buddhistischen und menschlichen Geister auf dem höchsten Berg der Welt machen ihn zu dem, was er ist: ein faszinierendes, schicksalhaftes Mysterium.
Berge sind nicht nur in Nepal Herberge für Geister. Lesen Sie hier, welche besondere Bedeutung der Ayers Rock in Australien für die Einheimischen hat.
Hier geht es zu einem Artikel über von Geistern bewohnte Vulkane und Berge zum Beispiel in Indonesien, Madagaskar und auch Deutschland.
















 http://www.burgerbe.de/2014/01/26/schloss-bronnen-spuk-schockt-nazi-fuhrerin/
http://www.burgerbe.de/2014/01/26/schloss-bronnen-spuk-schockt-nazi-fuhrerin/
 Foto: Stephanie Constantin
Foto: Stephanie Constantin


 Pinterest: static.panoramio
Pinterest: static.panoramio

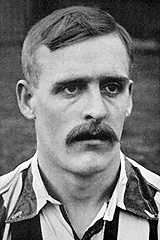
 Wikipedia
Wikipedia
