Superhelden faszinieren unsere Gesellschaft schon immer. In uns allen scheint eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen zu stecken. Heute sind Superhelden eigentlich überall – wir kommen im Kino, im Fernsehen und auch in Büchern nicht an ihnen und ihren heldenhaften Taten vorbei. Aber es ist uns auch möglich echte Superhelden auf den Straßen der Welt zu finden. Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, uns zu beschützen, gibt es heute nicht mehr nur in Fiktion und Fantasie. Wer sind diese Menschen und was bewegt sie zu ihren heldenhaften Taten?
Eine junge Frau von 24 Jahren, ein Holzflugzeug mit 80 PS und ein waghalsiger Plan: Die Welt im Alleinflug zu umrunden. Elly Beinhorn hob 1932 in Berlin ab und startete ihr Abenteuer in Richtung Indien. Knapp 8 Monate und 31 000 km später landete sie wieder in Deutschland. Dort wurde sie als Heldin gefeiert, und galt wenige Jahre später im Nationalsozialismus als Vorzeige-Deutsche. Ein Leben zwischen Weltreisen, Medienrummel und NS-Ideologie.
Wir leben in einer fantastischen Welt. Geister und der Versuch, sie auszutreiben, sind Realität. Jeder von uns hat schon mindestens einen Versuch unternommen, sich von einer bösen Macht zu befreien. Alles ein Hirngespinst? Da kommen wir der Sache schon näher…
Die Geister aufgeben

Unsere Vergangenheit ist ein Teil von uns – und doch kann sie uns zerstören, wie kaum etwas anderes. (Quelle: ShiftGraphiX, pixabay.com)
Wer im Jahr 2018 nicht an Geister glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Denn sie sind überall. Viele von uns kennen sie sogar persönlich, leben mit ihnen zusammen. Natürlich nicht freiwillig. Wer möchte sich schon gerne fürchten? Die Anderen dürfen nicht wissen, dass man einen geheimen Schatten hat. Man würde sonst ja für verrückt erklärt werden. Also, den Geist lieber still und heimlich ins obere Stübchen sperren. Denn eigentlich ist doch alles gut, im Grunde sind wir zufrieden, alles läuft in seinen Bahnen. Eigentlich. Wären sie nicht da. Die bösen Erinnerungen, die uns einfach nicht loslassen wollen. Die Leichen im Keller. Der Grund, warum wir nachts nicht ruhig schlafen können. Sie suchen uns heim. Sie lassen uns nicht los. Die Geister der Vergangenheit.
In der Theorie gibt es Möglichkeiten, sich von ungebetenen Gespenstern zu befreien. Von Geisterbeschwörung über Exorzismus bis hin zum Medium. Voraussetzung ist, dass echte Geister ihr Unwesen treiben. Echte Geister? Zumindest so echt, wie sie uns in Horrorfilmen und Gruselgeschichten verkauft werden. Kaum einer wird wohl daran glauben, dass diese Gespenster die Schwelle des Fiktiven je übertreten werden. Sollte das Unmögliche möglich werden, wüssten wir aus Erzählungen immerhin, was zu tun wäre. Das Ouija-Brett auspacken, den Priester rufen oder uns mit Kruzifix und Weihwasser wappnen. Kein Problem, kennen wir alles. Wir sind bereit.
Bei dir spukt’s wohl?!

Der erste Schritt ist, das eigene Schweigen zu brechen und sich Klarheit über seine inneren Dämonen zu verschaffen. (Quelle: Kat Jayne, Pexels.com)
Wirklich gruselig wird es dann, wenn wir machtlos sind. In der Realität ist vermutlich noch keinem von uns ein milchiger, schwebender Geist oder eine schwarze Dame erschienen. Wohl aber weiß jeder von uns um einen ganz bestimmten Spuk. Den Spuk im eigenen Kopf. Die Heimsuchung der eigenen Geister. Woher diese Geister kommen? Erschaffen in der Vergangenheit, gewachsen im Unterbewusstsein, genährt von unserem Gewissen. In unseren Gedanken treiben sie ihr Unwesen, und lassen sich nicht durch bloße Willenskraft vertreiben. Ein Exorzist wird hier nicht helfen, denn diese Geister sind hausgemacht. Jeder hat seine ganz eigenen Geister. Böse Erinnerungen, traurige Erlebnisse, Selbstzweifel oder seelische Verletzungen können die Quelle sein.
Die metaphorischen Geister sind jenen aus Gruselgeschichten ähnlich. Sie verfolgen uns, lassen uns keine Ruhe, quälen uns. Wir werden sie nicht los. Der Unterschied? Sie sind gefährlicher, Angst einflößender und mächtiger als Poltergeist und Kettenhemd zusammen. Wachsen aus unseren persönlichen Ängsten und Erlebnissen. Kennen unsere Schwächen. Sie wissen genau, wo wir angreifbar sind. Wir müssen lernen, unsere eigenen Geister zu beschwören. Geist bleibt Geist – sehen wir, was sich machen lässt!
Erlöse uns von dem Bösen
Möglichkeiten gibt es viele. In der Umsetzung ist allerdings Kreativität gefragt. Ein Kreuz am Rosenkranz um den Hals tragen. Das kommt dem ein oder anderen sicher bekannt vor. Anfang der 2000er sehr beliebt, vor allem bei den Promis damals nicht wegzudenken. Ein Mode-Hype oder tatsächlich ein echter Geister-Killer? Wer kann das schon so genau sagen?
Nächster Versuch: Einen großzügigen Schluck vom Weihwasser nehmen. Es soll ja der Heilige Geist darin stecken. Ob es ein Schluck aus der Schnapsflasche auch tut? Es müsste noch Himbeergeist im Schrank stehen… Wie sagt man noch? Feuerwasser? Teufelszeug? Besser nicht die Geister nähren! Oft versucht, oft gescheitert.
Noch ein Versuch: Gläser rücken. Kein schlechter Ansatz. Wobei, man belügt sich dabei ja doch nur selbst. Letztendlich bleibt das Medium. Wir lernen schon von klein auf, dass Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist. Probleme sollen verbal gelöst werden. Wie aber ein Medium finden? Jemanden, der unsere tiefsten Gedanken zum Vorschein bringt und uns dazu bewegt, uns mit unseren Geistern auseinanderzusetzen. Eine Person, die uns zuhört und versucht, uns mit den Geistern zu versöhnen. Ein Profi, der uns von unseren schlimmsten Gedanken befreit und uns Erlösung schenkt. Eine Idee?
Spätestens jetzt sollte auch dem Letzten klar sein, wie schmal der Grat zwischen dem Unerklärlichen und der Wirklichkeit ist. Gruselfilm und Spukgeschichte scheinen plötzlich nicht mehr unwirklich. Im Gegenteil: Wir leben mittendrin. Die Geister spuken in unseren Köpfen. Der Horror ist real.
Biete deinen Geistern die Stirn! Versteck dich nicht länger! Hol dir echte Hilfe:
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start
Vor ein paar Wochen habe ich mal wieder „Beetlejuice“ angesehen. Einen Film, den ich liebe, seit ich ihn mit ungefähr zehn Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Keine Frage, Tim Burton hat 1988 mit diesem Film definitiv seinen viertbesten Film abgeliefert, hinter „Ed Wood“ und „Big Fish“ und möglicherweise „Batman Returns“. Keine Sorge, es ist in Ordnung, wenn du das anders siehst. Du liegst falsch, aber es ist okay, wenn du mir nicht zustimmst.
Als Warnung, weil das dieser Tage natürlich immer wichtig ist: Dieser Text enthält Spoiler für „Beetlejuice“, einen dreißig Jahre alten Film. Welche Überraschung. Wenn ihr also den Film noch nicht kennt und mit Spoilern für einen dreißig Jahre alten Film ein Problem habt, dann schaut ihn euch schnellstmöglich an.

Filmplakat
Wenn ihr mit Spoilern kein Problem habt, aber trotzdem den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch jetzt trotzdem an. Macht euch keine Sorgen, ich kann warten. Speichert diesen Tab, geht auf Amazon und leiht ihn euch zum Streamen aus oder bestellt euch die DVD. Vielleicht gibt es den Film auch irgendwo kostenlos. Schaut ihn euch nur an. Tut euch den Gefallen. Ich warte solange.
Willkommen zurück. Was mich persönlich so an „Beetlejuice“ begeistert, ist, wie unglaublich optimistisch und sogar lebensbejahend er letztendlich ist. Klar, der Film beginnt mit dem überraschenden Unfalltod von Adam und Barbara Maitland. Letztendlich ist die Botschaft des Filmes im Grunde aber, dass der Tod dir nicht die Freude am Leben nehmen muss.
Noch kurz zum Plot
Kurz zur Handlung: „Beetlejuice“ beginnt mit dem tragischen Tod der Maitlands, dargestellt von Alec Baldwin und Geena Davis. In ihr nun leerstehendes Haus zieht alsbald die reiche Familie Deetz ein, bestehend aus Bauunternehmer Charles und seiner Frau, der Bildhauerin Delia (Jeffrey Jones und Catherine O’Hara), sowie Charles‘ Goth-Tochter aus erster Ehe, Lydia, gespielt von einer jungen Winona Ryder. Falls ihr euch je gefragt habt, was die Gute vor „Stranger Things“ gemacht hat. Die Maitlands, die von ihrer Sachbearbeiterin im Leben danach erfahren, dass sie für 125 Jahre in ihrem Haus bleiben müssen, beschließen, dass die neuen Bewohner*innen aus dem Haus verschwinden müssen. Doch ihre Spukversuche und Poltereien bleiben vergebens. In ihrer Ratlosigkeit beschließen die beiden, Hilfe bei dem selbstständigen Poltergeist Betelgeuse, dargestellt von Michael Keaton, zu suchen. Diese Entscheidung soll sich jedoch schon bald als Fehler herausstellen, denn Betelgeuse verfolgt voll und ganz seine eigenen Pläne.

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Via Giphy
Das ist gut, aber wir machen es ganz anders!
Soviel zunächst zum Inhalt. Tim Burton hat das Drehbuch des Films deutlich verändert. Die ursprüngliche Fassung war wesentlich düsterer und mehr Horrorfilm als explizite Horrorkomödie. In Tim Burtons Film weichen die Maitlands mit ihrem Auto einem Hund aus und fahren in einen Fluss, ihr Tod ist entschärft. In der Originalfassung des Drehbuchs von Autor Michael McDowell ist der tödliche Autounfall der Maitlands explizit und brutal. Später exhumieren sie den Dämon Betelgeuse, eine wesentlich grausamere Gestalt. Betelgeuse versucht in der Urversion auch nicht, die Familie Deetz zu vertreiben, sondern zu ermorden. Lydia ist im Drehbuch zwei Töchter, eine ältere und eine neunjährige jüngere Schwester. Betelgeuse versucht die erstere nicht nur zu heiraten, sondern explizit zu vergewaltigen, letztere wird nur verstümmelt. Charmant. Ihr wisst schon. Für Kinder.
Tim Burton hat wohl dieses Drehbuch gesehen und gemeint, dass man daraus bestimmt einen guten Film machen kann. ABER man muss ein paar Kleinigkeiten ändern. Aus der expliziten Gewalt des Todes der Maitlands wird ein sanfterer Tod, aus den beiden Töchtern der Familie Deetz wird Lydia. Und aus dem bösen Dämon Betelgeuse wird Michael Keatons überzogener Mix aus einem Gebrauchtwagenhändler und einem perversen Poltergeist.
Zum Besseren geändert
Die Änderungen waren wohl eine gute Entscheidung. Winona Ryders finale Version von Lydia wirkt gleichermaßen kindlich verletzlich als auch erwachsen und durch ihre Goth-Attitüde ist sehr sympathisch. Sie fühlt sich von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter missverstanden und als würde sie nicht ganz reinpassen. Somit macht es Sinn, dass sie sich Ersatzeltern in den Geistern der Maitlands sucht.
Doch die wohl beste Änderung des Filmes ist der titelgebende Geist selbst. Kein mörderischer Dämon aus den Niederhöllen, sondern der Betelgeuse, der Michael Keaton zu einem Superstar machte. Keatons Version des Charakters ist opportunistisch und fies. Er ist pervers, belästigt Barbara und hat eine abnormale Attraktion zu Lydia. Diese will er heiraten, um seinen Fluch zu brechen und in der Welt der Lebenden frei Unheil stiften zu können.
Betelgeuse ist im finalen Film nicht wirklich böse, eher selbstsüchtig, vollständig durchgeknallt und distanzlos. Was er vorher war, ist nicht ganz klar. Er behauptet, studiert und durch die Pest gelebt zu haben. Ob es stimmt oder nicht, das bedeutet nichts. Wichtig ist sein Dasein jetzt, als wahnsinniger Poltergeist.
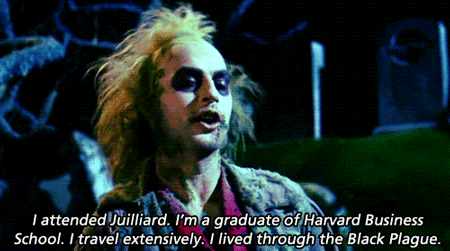
Erinnerungen eines Poltergeists an das Leben vor dem Tod. Via Giphy
Perfekter Poltergeist
Sein Leben vor dem Tod ist nicht von Bedeutung. Es ist impliziert, dass er Selbstmord begangen hat. In jedem Fall war er zwischenzeitlich Angestellter der Jenseitsbürokratie, wurde aber gefeuert. Nun verdingt er sich als „Bio-Exorzist”, herbeigerufen durch das dreimalige Aussprechen seines Namens. Michael Keaton spielt den Charakter in all seinem Wahnsinn, seinem Sarkasmus und seinen Gemeinheiten. Das alles unter zentimeterdickem Make-Up, ein Kunststück das nicht vielen Schauspieler*innen gelingt.
Doch Keaton geht in dieser Situation völlig auf. Er ist natürlich begabt für körperliche Comedy, seine Mimik ist selbst unter der Schminke wahnsinnig vielseitig. Warum um alles in der Welt wurde er seinerzeit nicht als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert? Dinge, die wir nie verstehen werden. Keaton begnügt sich damit, jede Szene, in der er vorkommt, zu stehlen und den Film zu seiner persönlichen Show zu machen. Überhaupt, Michael Keaton ist einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Das ist eine simple Wissenschaft.
Und eben so einen Schauspieler braucht es in dieser Rolle. Antagonist Betelgeuse bildet immerhin das Zentrum des Filmes. Der Aspekt des Poltergeisterns ist in diesem Film zentral. Der Geist ist laut, offensiv anstrengend, furchteinflössend und dabei extrem lästig für alle anwesenden. Und er hat dabei einen Heidenspaß. Diese Freude daran, allen auf die Nerven zu gehen. Daran, dass die Maitlands schnell bereuen, ihn um Hilfe gebeten zu haben, diese Freude am Schabernack ist es, was den Film so erinnerungswürdig macht.
Die Ewigkeit in der Warteschleife
Keatons Betelgeuse ist weniger ein durchtriebenes Böses, das besiegt werden muss. Vielmehr ist er eine Lästigkeit, die die beiden Familien, tot oder lebendig, zwingt, sich zusammenzuraufen. Die Moral der Geschichte ist eine, die das Leben bejaht und den Tod nicht als etwas Grundschlechtes, sondern vielmehr als einen neuen, abenteuerlichen Abschnitt des Lebens darstellt. Somit ist es eigentlich nur logisch, dass am Ende Lydia mit ihren Eltern und ihren toten Zieheltern feiert, dass sie eine Eins in Mathe hat, und der Antagonist bekommt was er verdient. Die Ewigkeit im Wartebereich in der Bürokratie im Jenseits. Schlimmer kann die Hölle auch nicht sein.
Bildquellen: © Warner Bros. & Warner Home Video all rights reserved
Wenn man an Schottland denkt, kommen einem unweigerlich Whisky, der Dudelsackspieler im karierten Schottenrock oder das Ungeheuer von Loch Ness in den Sinn. Der Norden Großbritanniens hat jedoch weitaus mehr zu bieten als Whisky & Co. Alte Steinkreise und -formationen, mittelalterliche Burgen und Schlösser sowie historisch bedeutende Kriegsplätze: Gerade wenn es um schottische Spuk- und Geistergeschichten geht, kommen Fans des Übernatürlichen auf ihre Kosten.
Edinburgh ist bekannt für seine engen und dunklen Gassen sowie steilen Treppengänge. Kein Wunder, dass sich viele Schriftsteller*innen von dem „Gruselcharme“ haben anstecken lassen, so u.a. der Autor Robert Louis Stevenson („Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“) oder auch „Harry Potter“-Schöpferin Joanne K. Rowling. Welche Geistergeschichten kursieren denn aber nun in Schottlands Hauptstadt?
Die Geister in Edinburghs Untergrund
Da wären zum einen der sogenannte kopflose Trommler, der durch die Räume des Edinburgh Castles schleicht und dessen Trommelgeräuschen man heute noch lauschen kann. Ebenso gibt es eine Frau namens Janet Douglas, auch bekannt als Lady of Glamis, die 1537 wegen Hexerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und nun regelmäßig in der Burg umherirrt.

Die Royal Mile ist die Verbindungsstraße zwischen dem Edinburgh Castle und dem Holyrood Palace. Foto: Natalie John.
Eine weitere spannende Geschichte ist die des verschollenen Dudelsackspielers. Vor einigen Jahrhunderten entdeckte man Tunnel unter der Royal Mile, von denen man annahm, dass sie Edinburgh Castle mit dem Holyrood Palace verbinden. Um der Sache auf den Grund zu gehen, schickte man einen Dudelsackspieler in die Gänge hinunter. Dabei sollte er auf seinem Instrument spielen, um mitverfolgen zu können, wo sich der Pfeifer gerade aufhält. Auf halbem Weg zwischen der Burg und dem Palast verschwand das Dudelsackspiel jedoch plötzlich. Sofort ließ man eine Rettungsmannschaft nach dem Musiker schicken, doch er ist seither nicht mehr gesehen worden. Noch heute, heißt es allerdings, kann man sein Lied auf der Royal Mile klingen hören.
Edinburgh Castle
Hoch über der Stadt Edinburgh thront das majestätische Schloss auf einem inzwischen erloschenen Vulkanfelsen. Größtenteils gebaut im 16. Jahrhundert und seitdem immer wieder Schauplatz von Plünderungen, Zerstörungen und Wiederaufbauten ist die Burg bekannt für ihre blutige und düstere Geschichte. Die wohl bekannteste Festung Schottlands ist somit nicht nur eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Edinburghs, sondern auch einer der gruseligsten Orte Schottlands mit der wohl höchsten Geisterdichte im ganzen Umkreis!
Immer wieder versuchen Wissenschaftler*innen nachzuweisen, was viele schon lange vermuten: die Existenz von Geistern innerhalb der Burgmauern. So auch der britische Psychologe Richard Wiseman, der 2001 ein Experiment mit 240 Freiwilligen durchführte. Wie BBC News berichtete, erkundete Wiseman in einer zehntägigen Studie mit seinen Testpersonen die dunklen Kammern und Kerker des Schlosses und beobachtete deren Verhalten. So gaben die Besucher*innen anschließend zu Protokoll, dass sie unterschiedliche Anzeichen von paranormalen Aktivitäten spürten. Einige fühlten eine Berührung im Gesicht oder ein Ziehen an der Kleidung. Andere wiederum bemerkten eine plötzliche Kälte oder ein brennendes Empfinden auf der Haut. Außerdem waren manche überzeugt, Schatten und Umrisse von Menschen zu sehen, obwohl sich definitiv keine im Raum befanden. Wiseman selbst zeigte sich nach dem Experiment allerdings immer noch skeptisch. Ob sich die Geheimnisse von Edinburgh Castle jemals wirklich lüften lassen, bleibt also fraglich.
Der einsame Highlander von Culloden
Kein anderer Ort vermag wohl das Trauma der Schotten deutlicher aufzuzeigen als Culloden, ein historisch bedeutender Landfleck in der Nähe von Inverness. Das heutige Wiesenfeld bestand im 18. Jahrhundert noch aus einer trostlosen Moorlandschaft. 1746 fand dort die blutige Schlacht zwischen der Armee von Charles Edward Stuart mit seinen Clanmitgliedern und den Engländern statt.
Keine 40 Minuten dauerte die Schlacht, in der die englischen Regierungstruppen die schottischen Highlander brutal niedermetzelten. Das Ereignis markiert einen Wendepunkt in der schottischen Geschichte, leitete es doch das Ende der schottischen Clans und ihrer Kultur ein. Ein idealer Schauplatz, der nach Geistererscheinungen und unnatürlichen Ereignissen nur so schreit. Wen wundert es also, dass Besucher*innen auch heute noch überzeugt sind, Kampf- und Kriegsgeschrei, Geschützfeuer sowie marschierende Füße und Trommelschläge wahrzunehmen? Außerdem gibt es Zeug*innen, die behaupten, sie hätten einen einsamen, erschöpften Highlander gesehen, der durch die Gegend schleiche und dabei immer wieder das Wort „besiegt“ vor sich hinmurmele.
Der älteste und gruseligste Pub Schottlands
Ohne Zweifel eignen sich alte Burgen und Schlösser sowie Schauplätze von blutigen Schlachten besonders gut für Spukgeschichten. In Schottland machen Geister jedoch auch vor „normalen“ Orten keinen Halt. So gilt im ältesten und wohl gruseligsten Pub alle Vorsicht, wenn es um unerwünschte und gespensterhafte Gäste geht. Im „Drovers Inn“, einem im Jahre 1705 eröffneten Gasthaus unweit des Loch Lomond, sollen Geister regelmäßig ein und ausgehen. Auf der Website des Gasthauses heißt es da zum Beispiel, dass ein junger Viehtreiber namens Angus vor 300 Jahren kaltblütig vor dem Inn ermordet und aufgehängt wurde. Nun soll er des Nachts durch den Pub wandern und nach seinen Mördern Ausschau halten, um Rache zu verüben. Außerdem gibt es da eine junge Bauernfamilie, die im 18. Jahrhundert auf dem Weg in die Unterkunft in einen Schneesturm geriet und in der Kälte erfror. Heute soll sie immer noch durch die Zimmer schleichen. Doch nicht nur solche Geistergeschichten machen den Pub zu etwas Besonderem, auch kuriose Berichte der Gäste selbst geben Rätsel auf. So berichtete eine Besucherin, dass sie eines Morgens Bilder auf ihrer Kamera fand, die sie schlafend zeigten. Weder Gäste noch Bedienstete konnten in das Zimmer gelangen, da es von innen abgeschlossen war. Ein weiterer unerklärlicher Vorfall ereignete sich bei einer Familie, die eine Geburtstagsfeier in dem Inn feierte. Auf den aufgenommenen Bildern der Party entdeckte die Mutter einige Tage später ein kleines Mädchen in einem rosa Kleid, das sie zuvor noch nie gesehen hatte. Weder gehörte es zu der Partygesellschaft noch waren an dem Abend überhaupt irgendwelche Kinder anwesend. Selbst die Angestellten des „Drover Inn“ waren ratlos. Im Übrigen beherbergt der Pub nicht nur Geister, auch Promis wie der schottische Schauspieler Gerard Butler sollen des Öfteren hier gesichtet worden sein.
Egal, ob in den Kerkern des Edinburgh Castles, auf dem Schlachtfeld von Culloden oder im ältesten Pub Schottlands: Geister scheint es in dem Land wohl zur Genüge zu geben. Wer also mal Lust verspürt, auf Gespensterjagd zu gehen oder einen Urlaub mit Gruselfaktor sucht, dem sei Schottland wärmstens empfohlen.
Gute Serien sind voller Geister. Die offensichtlicheren findet ihr bei eurem Streamingdienst mit dem Suchwort „Ghost“. Mehr Spaß hat aber, wer tiefer gräbt: Wir haben die ultimativen Tipps für großartiges Fernsehen mit Gespensterbeteiligung. Ganz ohne Bettlaken und Buh-Huh und stattdessen mit feinster Erzählkunst.
Drei Serien sollen hier vorgestellt werden: einmal absurde Philosophie, einmal Kult und schließlich ein ästhetisches Meisterwerk. Jede der Produktionen verdient ihren eigenen Binge-Marathon, aber unsere Tipps eignen sich auch für einen einzigen Fernsehabend. Wir haben die richtigen Episoden schon ausgesucht und machen darin eine kleine Gespensterführung: Wer sind die Geister von Netflix und Co? Und was wollen sie uns sagen?
„Believe it or not: Time’s arrow marches forward.“ (Bojack Horseman, S4 E2)
Bojack Horseman funktioniert nur ganz oder gar nicht und eine Folge genügt, um zu wissen, ob das existenzialistische Pferd mit Alkoholproblemen einem taugt. Ganz zu schweigen davon, ob man sich die linksliberale Attitüde der Zeichentrickserie geben will. Wer bis zur vierten Staffel gekommen ist, muss also Fan sein. In der zweiten Folge fahren wir mit Bojack nach Michigan, dort quartiert er sich im alten Sommerhaus seiner Familie ein. Offensichtlich spukt es dort: In Rückblenden tauchen die Großeltern und Bojacks Mutter auf und wir erfahren endlich, was Beatrice zu der schrecklichen Person gemacht hat, die sie ist. Ihr Bruder starb als Soldat im Zweiten Weltkrieg und für Trauer war kein Platz im Haus: „Time’s arrow marches forward“ kommentiert der Großvater lakonisch.
Was macht also Bojack dort? Er ist aus LA nach Michigan geflüchtet, nachdem eine Freundin an einer Überdosis gestorben war. Schuldgefühle bearbeitet er sonst mit Whiskey und Arschigkeit. Diesmal renoviert er das alte Haus, während die Zuschauer*innen parallel den Geistern der Vergangenheit dabei zusehen, wie sie an einem Familientrauma bauen. Es ist ein klassischer Bojack: Ein depressiv veranlagtes Pferd macht eine schwere Zeit durch und schrammt knapp an Hollywood-Plattitüden vorbei. An manchen Stellen möchte man weinen, aber dann ist es doch zu witzig, wie diese Tiere einfach Tiere sind. So sind die Geister in Bojack Horseman tragisch und komisch zugleich: Sie verkörpern ein allzu realistisches Familiendrama und unterhalten uns perfekt.
„There’s only ghosts here in the winter.“ Bojack Horseman, S 4 E 2
„I just have this really strong feeling that…” (Friends, S4 E2)
„…this cat is my mother”. Phoebe Buffay ist die fantastischste der sechs Freund*innen aus Friends. Die wirklich absurden Dinge haben meist mit ihr zu tun, besonders wenn es um Übernatürliches geht. So auch in dieser Folge: Phoebe hat soeben ein Konzert im Stammcafé beendet, da läuft eine Katze zu ihrem Gitarrenkoffer. Als Phoebe das Tier im Arm hält, wird ihr klar, dass der Geist ihrer verstorbenen Mutter in dem Tier sein müsse. Sie meint es ganz ernst und findet direkt untrügliche Hinweise: „How about the fact that she went into my guitar case? Which is lined with orange felt? My mother’s favorite fish was Orange Roughy. Cats like fish. Hi Mommy!“ Den Rest der Folge wird sie die Katze mit sich herumtragen. Keine*r der Freund*innen traut sich, ihr zu sagen, dass das Tier eigentlich Julio heißt und vermisst wird.
Für Phoebe hat die Katze eine klassische Geister-Funktion: Die Verstorbene ist zurückgekommen, weil ihre Tochter sich seit Neuestem mit einer „neuen Mum“ beschäftigt. Gespenstertypus: Heimsuchung. Phoebe hat erst kurz zuvor ihre eigentliche biologische Mutter kennengelernt (ihre tragische Kindheit als Kriminelle ist einer der Running Gags der Show). Ross, der Rationale, „Dr. Skeptismo“, will sie schließlich zur Vernunft bringen und konfrontiert sie mit ihren Schuldgefühlen, verkörpert durch die Katzen-Projektion. Da wird deutlich, wie klar sich Phoebe tatsächlich über ihre Gefühle ist: Sie erklärt Ross, dass er gar nicht wissen könne, wie es sich anfühlt, wenn ein verlorenes Elternteil zurückkäme. Denn seine Eltern leben noch. Am Ende kann sich nicht nur Phoebe mit ihrer „Mutter“ aussprechen und ihre Gefühle ausdrücken. Auch Ross entschuldigt sich bei der Katze: „Mrs. Buffay, it was insensitive of me to say you are just a cat, when you are clearly the reincarnated spirit of my friend’s mother.”
„…this cat is my mother.“ Friends, S 4 E 2
„The moon belongs to everyone.” (Mad Men, S 7 E 7)
Geister sind in Mad Men eigentlich nichts Ungewöhnliches: Don Draper, der Protagonist, sieht sie recht häufig. Gewöhnen kann man sich daran jedoch nicht, denn die meiste Zeit ist die Serie geradezu unheimlich realistisch, da ist kein Platz für Übersinnliches. Die Szene in der Mitte der letzten Staffel lässt sich auch nicht mit Alkohol oder Drogen erklären, sonst ein naheliegender Verdacht. Erst wenige Tage zuvor ist Bert Cooper verstorben, der kauzige Gründer von Don Drapers Werbeagentur. Ausgerechnet während er die Mondlandung im Fernsehen sah (es ist das Jahr 1969), hatte er einen Herzinfarkt. Und nun, an einem nüchternen Vormittag, steht er vor Don, lächelnd. Dann fängt er auch noch an zu singen, begleitet von tanzenden Sekretärinnen: „The moon belongs to everyone. The best things in life are free.“ Es treibt Don die Tränen in die Augen, und hinterlässt beim Publikum eine unheimliche Vorahnung.
Ist das jetzt ein unterhaltsamer Hinweis auf den ikonischen Abwärtsdrang, seit sieben Staffeln vom Vorspann vorhergesagt? Ein Wink aus dem Jenseits für Don, der ohnehin noch nie so sehr am Abgrund stand wie in diesen letzten Folgen vor dem Finale? Am meisten irritiert die Fröhlichkeit des Auftritts. Die vorherigen Geistersichtungen waren angemessen düster (tragisch verstorbene Familienmitglieder, Kollegen, Liebhaberinnen). Jedes Mal rufen sie dem Publikum wieder in Erinnerung, dass die Hauptfigur eigentlich selber ein Geist ist: Donald Draper ist tot. Der schicke Werbemensch, von dem die Serie handelt, heißt eigentlich Dick Whitman, und hat im Koreakrieg die Identität eines gefallenen Kameraden angenommen. Jeder Geist weist uns wieder darauf hin: Bei Mad Men geht es genauso sehr um Werbung wie um den Tod. Von den vorgestellten Serien sind Don Drapers Geister daher die metaphysischsten. Und angenehm absurde Erscheinungen in der sonst hyperrealistischen Ästhetik der Serie.
„The best things in life are free.“ Mad Men, S 7 E 7
Wer jemandem die Haare gewaltsam abschneidet, demonstriert Macht. Für das Opfer bedeutet es Demütigung. „Horizontale Kollaborateurinnen“, angebliche Hexen, Sklaven – ein Blick in die Geschichte zeigt: Das Kahlscheren ist immer wieder angewendet worden, um zu bestrafen, Kräfte zu brechen oder Menschen zu entwürdigen.
Die Weltmeisterschaft 2018 ist in vollem Gange – und neben den fußballerischen Qualitäten ist wieder einmal auch die Präsenz neben dem Platz, insbesondere in Form einer ausgefallenen Frisur, gefragt. Dieser Beitrag soll einen Blick auf die Wettbewerbe vergangener Tage werfen. Welche der Haarprachten sind in Erinnerung geblieben? Und welche waren eher ein modischer Totalausfall?
In Ostasien kennt jedermann das 9–jährige Mädchen Maruko-Chan. Die Protagonistin der populären Manga-Serie ist seit 1986 bekannt und findet bis heute viele Liebhaber unter den Erwachsenen. Ein Grund dafür sind die heiteren Alltagsgeschichten des kleinen Mädchens sowohl in der Schule als auch zu Hause mit ihrer Familie. Noch einer ist sicherlich ihre sympathische Frisur, die die Leute in Taiwan immer an eines erinnert: die Haar-Vorschrift an Schulen. Weiterlesen
Schaut man sich unsere evolutionär nächsten Verwandten an, so fällt einem vor allem ein Merkmal auf: alle Menschenaffen sind an ihrem gesamten Körper mit Fell bedeckt, wir Menschen hingegen nicht. Dabei hat das Fell eigentlich viele Vorteile für seine Träger. So können Tiere mit Fell tags und nachts aktiv sein, da Haare vor Kälte gleichsam wie vor zu viel Sonneneinstrahlung schützen. Damit sind die Tiere weniger von den Temperaturunterschieden abhängig. Auch können viele Tiere über ihr Fell kommunizieren. Das Aufstellen der Haare kann ein Zeichen für Angriff, Verteidigung oder Angst sein. Das Einzige, was uns Menschen davon noch als Relikt geblieben ist, ist die Gänsehaut.
Nacktheit als Vorteil
In der Evolution setzt sich nur derjenige mit der besten Anpassung und der höchsten Fitness durch. Demnach muss die Nacktheit uns Menschen im Laufe der Zeit also einen Vorteil gebracht haben. Mit Hilfe verschiedener Funde konnte nachgewiesen werden, dass unsere Vorfahren durch die Evolution ihr Fell immer weiter reduzierten. In einem 3.sat-Artikel wird erläutert, dass in der sexuellen Selektion Partner mit weniger Fell bevorzugt wurden, wodurch über viele Generationen die behaarten Zonen des Menschen immer weniger wurden. Wieso genau der Mensch sein Fell verlor, ist nach wie vor nicht ganz sicher geklärt. Es gibt jedoch mehrere Theorien, die von unterschiedlichen Wissenschaftlern vertreten werden.
Fellverlust durch schweißtreibende Bewegung
Die erste und bisher gängigste Theorie geht davon aus, dass der Verlust des Fells mit der jagenden Lebensweise des Frühmenschen zusammenhängt. Wie in einem Artikel des Wissenschaftsmagazins Spektrum erläutert, hatte der Homo ergaster, welcher vor 1,6 Millionen Jahren lebte, schon ähnliche Körperproportionen wie der Mensch heute. An den Knochen erkannten Forscher, dass er viel wanderte, rannte und von der Jagd lebte. Die Regenwälder gingen durch klimatische Veränderungen in dieser Zeit immer weiter zurück. Es entstand ein weitläufiges Savannengebiet mit knapperem Nahrungsangebot und weit auseinanderliegenden Wasserstellen. Durch die Anpassung an die neuen Lebensumstände musste der Homo ergaster ausdauernd laufen und seine Körpertemperatur gut regulieren können. Ein Fell wäre dabei sehr hinderlich gewesen. Der Körper hätte sich in der afrikanischen Savanne bei dieser Ausdauerbelastung zu stark aufgeheizt und der Gefahr eines Hitzschlags ausgesetzt. Durch die Kombination aus weniger Fell und die Vermehrung der Schweißdrüsen passte sich der Frühmensch gut an die neuen Anforderungen an.
Auch felltragende Tiere besitzen Schweißdrüsen und können schwitzen. Sie tun dies jedoch deutlich weniger effektiv als unsere Vorfahren, da der Schweiß die Haare verklebt und eine Wärmeabfuhr des Körpers dadurch eher verhindert wird. Bis zu zwölf Liter kann ein Mensch am Tag schwitzen und dadurch seinen Körper auch über eine längere Zeit der Anstrengung und Belastung hinweg kühlen. Wir haben also eine im Tierreich einzigartige Regulierung der Körpertemperatur entwickelt und sind so vielen Tieren in Sachen Ausdauer um einiges voraus.
Trotzdem zweifeln viele Wissenschaftler wie der Biologe Mario Ludwig diese Theorie an. Sie sehen in der fehlenden Behaarung eine Gefahr für das Leben in der Savanne. Ohne Fell wird die bloße Haut dort der UV-Strahlung ausgesetzt und somit steigt das Risiko für Sonnenbrand und Hautkrebs.
Fellverlust zur Parasitenbekämpfung
Eine weitere und neue Theorie wird unter anderem von den britischen Forschern Walter Bodmer und Mark Pagel vertreten. Sie besagt, dass der Fellverlust eine Reaktion auf Parasitenbefall war. Menschen begannen mit der Zeit sozial zu leben, Verbände zu gründen und sesshaft zu werden. Für viele Parasiten hätte dies beste Bedingungen zur Ausbreitung geboten. Um sich in diesen neuen Lebensgemeinschaften besser vor Läusen, Flöhen und anderen Ektoparasiten schützen zu können, war es also hilfreich, möglichst wenig Fell zu besitzen. Durch die voranschreitende Nacktheit konnten demnach Übertragungsmöglichkeiten für Krankheiten reduziert werden, da das Ungeziefer an glatter Haut schlechter haftet als an Fell. Auch ging damit eine enorme Zeitersparnis einher, da das über Stunden andauernde „Lausen“ wie man es bei vielen Affenarten noch beobachten kann, wegfiel. So konnte mehr Zeit für das Jagen und Sammeln genutzt werden. Außerdem lernten die Menschen, Feuerstellen gegen Kälte anzulegen. Zudem wurde Kleidung hergestellt, welche Schutz bot und sich leichter reinigen ließ als ein Fell.

Das dichte Affenfell muss mehrere Stunden am Tag nach Ungeziefern durchsucht werden. ©Alexas_Fotos, pixabay
Trotzdem noch ein wenig Rest-Fell
Welche Theorie nun der Sache am nächsten kommt, ist bisher noch nicht geklärt. Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Erklärung, oder es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Relativ einig sind sich die Forscher jedoch bei der Frage, warum der Mensch trotzdem an manchen Stellen des Körpers eine dichtere Behaarung behalten hat.

Ein Überbleibsel des ehemaligen Fells: ein dünner Flaum bedeckt noch immer fast unseren gesamten Körper. ©physicsgirl, pixabay
So schützt das Kopfhaar unser hitzeempfindliches Gehirn vor zu starker Sonneneinstrahlung, sowie vor Kälte und Hautverletzungen. Auch hat es eine ästhetische Wirkung und steigert die sexuelle Attraktivität. Das Schamhaar soll vor allem die empfindlichen Genitalien schützen. Dazu schafft es visuelle Reize und steigert die Wirkung von Pheromonen (Sexualduftstoffen). Außerdem ist fast unser gesamter Körper von einem dünnen Flaum bedeckt. Britische Wissenschaftler vermuten, dass diese dünnen Haare ebenfalls zum Schutz vor Parasiten dienen. Menschen spüren die Blutsauger eher und die Zecken, Läuse und ähnliches brauchen länger, um eine geeignete Bissstelle zu finden.
Trotz Fellverlusts fanden die Menschen unterschiedliche Möglichkeiten mit anderen Individuen zu kommunizieren. So kam es zu Körperbemalungen, dem Tragen von Schmuck, dem Verfeinern von Mimik und natürlich der Entwicklung von Sprache. Es scheint also, dass der Mensch sich im Laufe der Evolution nicht nur in seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten steigerte, sondern sich ebenso im Bereich der Körperbehaarung immer weiter optimierte.
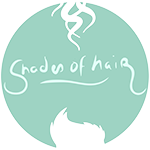
Weiterführende Links:
Video: Das Erste: Haarige Sache: Haare im Wandel der Evolution
Podcast: Deutschlandfunk Nova: Das Tiergespräch: Warum der Mensch sein Fell verloren hat
Originalstudien:
Human skin pigmentation as an adaptation to UV radiation


 Bundesarchiv, Bild 102-11633 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 102-11633, Berlin-Tempelhof, Ankunft von Elli Beinhorn (cropped), cropped by Nadja_, CC BY-SA 3.0 DE
Bundesarchiv, Bild 102-11633 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 102-11633, Berlin-Tempelhof, Ankunft von Elli Beinhorn (cropped), cropped by Nadja_, CC BY-SA 3.0 DE

 Natalie John
Natalie John

 pixabay edited, pngimg edited
pixabay edited, pngimg edited Life Photo Collection chez Google Arts & Culture
Life Photo Collection chez Google Arts & Culture Ronnie MacDonald, Wikimedia Commons
Ronnie MacDonald, Wikimedia Commons
 https://pixabay.com/de/gorilla-kind-trennung-schmerz-2322005/
https://pixabay.com/de/gorilla-kind-trennung-schmerz-2322005/
