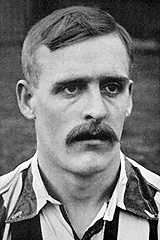Grüne Käfer, rote Schuhe oder gelbe Blumen. Farben in Träumen faszinieren uns und regen nicht selten zur Traumdeutung an. Aber was ist, wenn wir in Schwarzweiß träumen? Wie das mit unseren Medienerfahrungen zusammenhängen könnte, klärt ein Blick in die ‚Traumfarbforschung‘ der letzten hundert Jahre.
Ein Kind sitzt auf einem Dreirad. Die Räder quietschen, das Lenkrad wackelt und der Blick nach vorne offenbart eine menschenverlassene Stadt. Unzählige Wolkenkratzer machen ihrem Namen alle Ehre und verschwinden im Grau des Himmels. Die Gassen dazwischen engen auf den ersten Blick ein. Sobald das Dreirad um die Ecke quietscht, breitet sich die Entfernung zwischen den Betonfassaden jedoch ins Unendliche aus. Eine Unendlichkeit von Schwarz-, Weiß- und Grautönen. Kein Fensterrahmen, kein Straßenschild, keine Dreiradpedale in dieser Stadt sind in Farbe getaucht. Alles ist schwarzweiß. An diesen Traum kann ich mich erinnern, seit ich Dreirad fahren kann. Zumindest glaube ich mich daran erinnern zu können. Ein Traum ganz ohne Farbe – kann das überhaupt sein?
Traum oder Film?
Die Traumforschung ist sich darin einig, dass Sorgen, Tätigkeiten und Erfahrungen aus dem Alltag den Inhalt eines Traums beeinflussen. Meine Dreiradfahrt durch den schwarzweißen Großstadtdschungel erinnert jedoch eher an eine Szene aus einem Film Noir. In der nächsten Sequenz könnte sich ein graugekleideter Ermittler, an eine Betonwand gelehnt, seine Zigarette anzünden. Eine in Schatten getauchte Frau würde derweil in eines der Hochhäuser stöckeln, den Blick des Ermittlers auf ihrem Rücken…
Bereits 1926 sprach der Regisseur René Clair von einer besonderen Nähe zwischen Zuschauer*innen eines Kinofilms und Träumenden, die in den Bann ihres Traums gezogen werden. Der klinische Psychologe Robert Van de Castle beschreibt in seinem Buch Our Dreaming Mind tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Trauminhalten. Vor allem emotionale Szenen sollen demnach beeinflussen, welche Geschichten sich nachts in unserem Unterbewusstsein abspielen. Aber auch die formalen Aspekte von Medien scheinen sich in Träumen wiederzufinden. 1961 behauptete der Psychoanalytiker Ángel Garma sogar, Träume seien wie Stummfilme, ohne Ton oder Farbe.
Technicolor-Träume
Können Medien also auch beeinflussen, ob wir in Farbe träumen oder nicht? Die Psychologin Eva Murzyn wollte in einer 2008 veröffentlichten Studie genau diese Frage beantworten. Hintergrund dafür lieferten Unstimmigkeiten, die der Philosoph Eric Schwitzgebel feststellen konnte, als er frühe Traumstudien mit später durchgeführten Erhebungen verglich. Im frühen 20. Jahrhundert waren nicht nur Filme schwarzweiß, sondern auch Träume sollen im Regelfall keine Farben enthalten haben. In einer 1915 durchgeführten Studie träumten nur 20 Prozent der Proband*innen in Farbe. Ebenfalls im Jahr 1915 gründete der US-amerikanische Geschäftsmann Herbert Kalmus das Filmunternehmen Technicolor, welches circa vier Jahrzehnte später den Farbfilm revolutionieren sollte. Nicht ohne Grund nannten Traumforscher*innen Farbträume damals ‚Technicolor-Träume‘.
Während sich heute ganze Webseiten und Bücher der Frage widmen, was bestimmte Farben im Traum zu bedeuten haben, waren all diese Traumfarben in den Fünfzigern nur eins: Symptome einer psychischen Krankheit. Forscher*innen des St. Louis Krankenhauses in Missouri fanden diese bei psychisch erkrankten Patient*innen etwa drei Prozent häufiger als bei anderen Patient*innen des Krankenhauses. Auffällig ist nun, dass sich diese Auffassung in den Sechzigern änderte. In einer Studie von 1962 gaben rund 83 Prozent der Befragten an, in Farbe zu träumen. Parallel zu diesem neuen Farbanstrich der Traumwelt machte aber auch eine ganze Industrie Fortschritte in Richtung Farbe: die Filmindustrie.
Medien als Traumvorbilder

Die Dreistreifenkamera von Technicolor revolutionierte Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts die Filmindustrie. © Marcin Wichary
Die internationalen Kinoleinwände erstrahlten ab den Vierzigern in immer mehr Farben, Ende der Sechziger produzierte die Traumfabrik fast alle Filme in Color. Zudem besaß die Mehrheit aller US-amerikanischen Haushalte 1972 einen Farbfernseher. Farbmedien ersetzten Stück für Stück ihre schwarzweißen Vorgänger. Eva Murzyn stellt in ihrer Studie zwei Ansätze vor, die erklären, wie diese Entwicklung für den Umbruch in der Traumforschung verantwortlich sein könnte: Entweder beeinflussen Medien direkt die Traumform und somit auch die Farbgebung, oder sie beeinflussen lediglich die Annahmen darüber, wie Träume auszusehen haben. Da Träume nur selten im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, vergisst man schnell Details zu Form und Inhalt des Geträumten.
Allein die Annahme, dass Träume typischerweise schwarzweiß sind, kann die Wahrnehmung verzerren und eigene Träume im Nachhinein farblos erscheinen lassen. Frühe Dokumentationen zu Träumen legen laut Murzyn nahe, dass Menschen vor dem 20. Jahrhundert mehrheitlich in Farbe träumten. Damals, so argumentiert die Psychologin in ihrer Dissertation, gab es auch noch keine Filme, die als Vorlage zur eigenen Realitäts- und Traumwahrnehmung dienten. Menschen, die hauptsächlich Schwarzweißfilme konsumieren, passen ihr Traumerlebnis also an das mediale Vorbild an. Die Träume erscheinen somit in Retroperspektive farblos.
Die Farben der Kindheit
Und wie kommt es, dass Menschen heute noch behaupten, schwarzweiße Träume zu haben? Eva Murzyn untersuchte in ihrer Studie die Träume von 60 Personen darauf, ob sie diese als grau oder bunt wahrnehmen. Dabei teilte sie die Proband*innen in zwei Gruppen auf: die unter 25-Jährigen und die über 55-Jährigen. Den Traumtagebüchern und Befragungen konnte Murzyn schließlich entnehmen, dass in der jungen Gruppe durchschnittlich nur etwa 4 Prozent der Träume schwarzweiß ausfallen. Die älteren Proband*innen hingegen konnte sie nochmals in zwei Gruppen spalten. Diejenigen, die bereits im Grundschulalter Farbfernsehen konsumierten, träumten zu über 90 Prozent in Farbe. Von den Studienteilnehmenden, die mit Schwarzweißmedien aufwuchsen, behauptete jede*r Vierte noch immer, in Grautönen zu träumen. „Es könnte also eine kritische Periode in der Kindheit geben, in der Filme eine wichtige Rolle dabei spielen, wie unsere Träume aussehen“, mutmaßt Murzyn.
Der schwarzweiße Großstadttraum aus meiner Kindheit kann also noch immer nicht vollständig erklärt werden. Ich gehöre zweifellos zur Generation Farbfernsehen und träume auch sonst nicht in Grautönen. Aber wer weiß, vielleicht hat das dreiradfahrende Mädchen vor dem Schlafengehen ein paar Blicke auf einen schwarzweißen Krimi erhaschen können. Oder vielleicht verzerrte ein späterer Stummfilmmarathon die Erinnerung an die Fahrt durch den Wald aus Wolkenkratzern. Denn Medien haben eine Wirkung auf die Farbwelt unserer Träume – egal, ob sie sich bereits im Schlaf in Grautönen abspielen oder unser Gedächtnis das Geträumte erst im Nachhinein schwarzweiß einfärbt.
© Titelbild: Unsplash
Ihr habt noch nicht genug von unseren Traum-haften Beiträgen? Dann folgt uns für einen Blick hinter die Kulissen, spannende Fun-Facts oder Musik-Inspirationen auf Instagram und Twitter!
Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!