Eine vermeintlich unheilbare Krankheit, ein tödlicher Schuss direkt ins Herz, Eins gegen Hundert – nichts kann an der Unsterblichkeit der Hauptcharaktere rütteln. Mehrfach werden sie umgemäht, kehren aber emsig, wie Stehaufmännchen, durch den sogenannten Plot Armour beschützt, immer wieder auf wundersame Weise ins Leben zurück, statt brav ins Gras zu beißen. Weiterlesen
Beiträge
„Angst, Potter?“ -„Träum weiter!“ – Eine Fantheorie unter die Lupe genommen
„Wenn wir träumen, betreten wir eine Welt, die ganz und gar uns gehört. Vielleicht durchschwimmt er gerade den tiefsten Ozean oder gleitet über die höchste Wolke“, flüstert Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore im dritten Harry-Potter-Film über den vermeintlich schlafenden Harry gebeugt. Wenn Dumbledore nur wüsste, dass Fans der Buchreihe vermuten, Harry hätte ihn, Hogwarts und die gesamte Zauberwelt nur erträumt. Wir schauen uns eine der verrücktesten Harry-Potter-Theorien genauer an.
Kuriose Fantheorien gibt es nahezu über jedes bekannte Franchise: Fans interpretieren gern Zweideutiges, rätseln über ungelöste Geheimnisse oder rücken mal eben die gesamte Geschichte in ein anderes Licht. Davon bleibt auch die von der britischen Schriftstellering J.K. Rowling erschaffene Harry-Potter-Welt nicht verschont. Theorien wie solche, dass Harrys bester Freund Ron in Wahrheit ein zeitreisender Dumbledore sei, kursieren in zahlreichen Foren und werden heiß diskutiert. Eine dieser Theorien sticht jedoch besonders heraus: Harry sei eigentlich gar kein Zauberer, sondern hätte sich seine Abenteuer nur erträumt. Die miserable Erziehung durch Tante und Onkel Dursley, seinen Zieheltern, hätte Harry dazu veranlasst, sich in eine andere Welt zu fantasieren – in eine, in der er selbst der Held ist und die Macht hat, das Böse zu bekämpfen. Was soll man auch anderes tun, wenn man Zeit seines Lebens in einem Schrank unter der Treppe eingesperrt ist?
Die Theorie stellt Harry als einen psychisch hochgradig belasteten Jugendlichen vor, welcher als Bewältigungsstrategie gleich eine ganze Welt erträumt. Demnach seien Harrys Eltern auch gar nicht von dessen Erzfeind Lord Voldemort getötet worden, sondern tatsächlich bei einem Autounfall gestorben. Ganz so, wie die Dursleys es Harry auch beigebracht haben, um ihn so fern wie möglich von seinem Schicksal als Zauberer zu halten. Das Aufwachsen ohne Eltern und die schlechte Behandlung durch die Dursleys führten schließlich zu seinem psychisch labilen Zustand. So erschütternd diese Theorie auch klingt, die originellen Ausschmückungen der Fans erlauben es unserer Meinung nach, zur genaueren Betrachtung ein klein wenig Galgenhumor in den Gerüchtekessel zu streuen.
Ein Ausraster bringt Harry geradewegs in die Psychiatrie
Der Fantheorie zufolge hatte Harry die miese Erziehung und die Sticheleien seines Cousins und Ziehbruders Dudley satt und beendete den Aufenthalt bei Onkel und Tante mit einem gewaltigen Knall. Im ersten Teil Harry Potter und der Stein der Weisen ist es der Halbriese Hagrid, welcher Harry aus den Fängen der Dursleys befreit, Dudley als Strafe ein Schweineschwänzchen ans Gesäß zaubert und den kleinen Zauberer dorthin bringt, wo er eigentlich hingehört: Nach Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. In ‚Wahrheit‘ soll es Harry selbst gewesen sein, der in einem wilden Anfall den wehrlosen Dudley angegriffen und gefährlich verletzt hat. Das Resultat: der direkte Weg in die Psychiatrie. Bye, Harry.

„Harry, du bist ein Zauberer“, heißt es im ersten Teil an dieser Stelle. Was Hagrid laut Fantheorie wohl eigentlich sagen wollte: „Harry, du bist psychisch krank.“
© Runa Marold
Hogwarts ist gar keine Schule
An dieser Stelle öffnet sich erstmals die Tür zu Harrys fantastischer Traumwelt. Anstatt einer Psychiatrie hat der vermeintliche Zauberer plötzlich ein sagenumwobenes Schloss voller Magie, Wunder und jeder Menge Obskuritäten vor sich. Geister tauchen aus Esstischen hervor, Treppen verschieben sich nach eigenem Willen, Kinder bringen Federn mit Zauberformeln zum Schweben, und in einer geheimen Kammer haust ein gefährlicher dreiköpfiger Hund. Klingt ziemlich irre, oder? Dachten sich auch die Vertreter*innen der Fantheorie und fühlten sich sofort an abstruse Bilder aus anderen filmischen Interpretationen von Psychiatrien erinnert. Harry soll sich demnach von den verrückten Machenschaften anderer Anstaltbewohner*innen inspirieren lassen und darauf aufbauend seine Fantasie-Zauberwelt ersonnen haben. Dumbledore und die anderen Lehrer*innen seien eigentlich die angestellten Ärzt*innen, welche ihr Bestes versuchen um die psychisch kranken Insassen zu behandeln. Und der dreiköpfige Hund? Vielleicht nur eins der von Harry gehassten Therapie-Kuscheltiere. Wer nennt so ein Monstrum schließlich Fluffy?

Hogwarts, die Schule für Hexerei und Zauberei – ist in Wahrheit gar nicht so magisch? Wilkommen in der Psychiatrie, Harry.
© Runa Marold
Harry ist der Star seiner eigenen Welt
Zauberer-Dasein hin oder her, Harrys Identität besteht bei weitem nicht nur aus der Fähigkeit, mit Zaubertricks zu begeistern. Er ist obendrein auch noch der berühmteste Junge der ganzen Zauberwelt. Ein weiteres Indiz für die Fans: Ein vernachlässigter Junge ohne feste Bindungen stellt sich vor, als Auserwählter heldenhaft gegen das Böse zu kämpfen und plötzlich Freunde zu finden, die ihm kopfüber in jede Gefahr folgen. Im auf Besen ausgetragenen Schulsport Quidditch zeigt Harry unvergleichbares Talent, Dumbledore höchstpersönlich ist an ihm interessiert wie an keinem anderen, und der Oberbösewicht Lord Voldemort hat es nur auf ihn abgesehen. Geht es noch klischeehafter?

Harry, der Held aller Zauberer und Hexen? Wer’s glaubt.
© Runa Marold
Dumledore ist Harrys persönlicher Therapeut
Dumbledores Interesse an Harry begründet sich in den Büchern über das wundersame Triumphieren von Baby-Harry über Lord Voldemort. Zahlreiche Gespräche finden über die Jahre hinweg zwischen Harry und Dumbledore statt, alle von ihnen sind von den weisen Ratschlägen des Schulleiters geprägt. Tiefgründige Gespräche über Harrys Dasein? Moment, das klingt doch ganz nach Therapie – denken sich die Verfechter*innen der Theorie und sehen Dumbledore in Wahrheit in der Rolle eines Psychiaters. Anhaltspunkt für diese Interpretation bietet eine im ersten Buch stattfindende Unterhaltung der beiden über den Spiegel Nerhegeb, welcher seinen Betrachter*innen ihre sehnlichsten Wünsche zu offenbaren vermag. Dumbledore warnt Harry davor, dass es Menschen gäbe, die bei seiner Betrachtung wahnsinnig geworden wären. Sie wüssten nicht mehr, ob ihnen der Spiegel etwas Wirkliches oder etwas Wünschenswertes zeige. Hat Harry hier die offene Warnung vor dem Abdriften in seine Traumwelt verarbeitet? Wer weiß. Im Buch erklärt Dumbledore daraufhin, dass er beim Blick in Nerhegeb sich selbst mit einem Paar dicker Wollsocken sehe. Vorausgesetzt, dieses Gespräch entspringe auch nur Harrys Fantasie: Was würde Freud wohl dazu sagen?

Lieber Harry, neigst du etwa in Wahrheit auch zur Gerontophilie? Dumbledore ist zumindest nicht gerade in deinem Alter.
© Runa Marold
Die augenscheinlich Verrückten in Harrys Welt
Wäre Hogwarts eine Psychiatrie, würde das bedeuten, dass Harrys Mitschüler*innen in Wahrheit seine Mitpatient*innen sind. Die Fantheorie begründet diese Behauptung damit, dass einige von ihnen offenbar auch in Harrys Traumwelt nicht mehr alle Tassen im Schrank hätten. Allen voran hüpft die schrullige Luna Lovegood mit ihrem Glauben an Wesen, welche sogar in der Zaubererwelt nur als Hirngespinste belächelt werden. Ihr Name Luna erinnert an lunacy, das englische Wort für Wahnsinn, was diese Deutung unterstützen soll. Ein weiteres Indiz soll der unter Verfolgungswahn leidende Alastor „Mad-Eye“ Moody darstellen. Er tritt im vierten Teil der Reihe zunächst als neuer Lehrer auf, wird am Ende des Schuljahrs jedoch durch die Täuschung über seine wahre Identität selbst zur Gefahr. Sein Nachname bedeutet so viel wie launisch oder unausgeglichen. „Immer wachsam“, poltert Moody stets seinen Schüler*innen entgegen, und die Fantheorie heißt damit die Paranoia in der Hogwarts-Psychiatrie willkommen.

Alastor „Mad-Eye“ Moody und Luna „Loony“ Lovegood: als wäre Harrys eigener Wahnsinn noch nicht genug. © Runa Marold
Lord Voldemort ist Harrys dunkle Seite
Zu guter Letzt vermutet die Fantheorie hinter dem gefährlichen Hauptantagonisten Lord Voldemort eine Projektion von Harrys innerem Wahnsinn. Zwischen beiden Figuren existieren tatsächlich viele Parallelen: Beide sind als Waisen aufgewachsen, gelten in der Zauberwelt als Halbblüter und ihre Zauberstäbe tragen mit den Federn desselben Phönix’ den gleichen Kern. Im Laufe der Geschichte hat Harry immer wieder Visionen und Träume von Voldemort, später teilen sie sogar ihre Gedanken. Der sich durch alle Bücher ziehende Kampf der beiden soll Harrys Bemühungen verarbeiten, Herr über seine psychischen Probleme zu werden. Ein weiteres Indiz sei außerdem der Mord an Harrys Mitschüler Cedric Diggory. Dieser stelle, so die Vermutung, Harrys Wunsch-Ich dar: ein glücklicher, überall beliebter und gut behüteter Junge. Zu perfekt um wahr zu sein, denkt sich Fantheorie-Harry und benutzt sein Alter-Ego Voldemort um Cedric in seiner Traumwelt zu töten. Böser Harry.

Harrys stillschweigende Gedanken: „Tod den Muggeln, Tod den Schlammblütern! Weltherschafft, muhahaha.“ Dream big, Harry.
© Runa Marold
Ein Fünkchen Wahrheit?
Den Galgenhumor beiseite genommen, erscheint die Fantheorie je nach Betrachtungsweise sogar durchaus plausibel. J.K. Rowling erwähnte bereits in einem Interview, dass sie auch selbst mehr als einmal daran gedacht habe, dass Harry im Schrank tatsächlich verrückt geworden sei und ein Fantasieleben entwickelt habe. Auch wenn es denkbarer erscheint, dass die eigentliche Intention für den Kinder- und Jugendroman eine andere war – eines steht fest: Harry Potter ist zu Zaubereien fähig, von denen unsereins nur zu träumen wagt. Und das kann wahrlich neidisch machen. Den heldenhaften Zauberer zu einem Fall für die Psychatrie zu degradieren, wirkt also durchaus menschlich. Es zeigt das Bedürfnis, diese magische und fantastische Welt mit der eigenen Realität in Einklang zu bringen. Wenn wir von einem Leben als Zauberer oder Hexe träumen können, wieso sollte es Harry in unserer Welt nicht genauso ergehen? So oder so ist es stets spannend zu beobachten, welche wundersamen gedanklichen Abzweigungen sich uns dank der Träumereien von Fans eröffnen können. Oder wer ist hier eigentlich am Träumen?
Vielen Dank an Zwischenbetrachtung-Autorin Runa Marold für die visuellen Pointen!
Titelbild: ©unsplash
Ihr habt noch nicht genug von unseren Traum-haften Beiträgen? Dann folgt uns für einen Blick hinter die Kulissen, spannende Fun-Facts oder Musik-Inspirationen auf Instagram und Twitter!
Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!

In „Herr der Ringe“ wird Frodo von Nazgul verfolgt, Harry Potter badet in Gesellschaft der Maulenden Myrte, der Geist von Aslan wacht über Narnia und Mina heiratet dem Vampir Dracula. Fantastische Literatur stellt unbegrenzte Möglichkeiten nicht lebende Kreaturen zu bilden, die noch immer in der „realen“ Welt existieren. Aber was für eine Realität konstruieren die Autor*innen und was für eine Rolle spielen ihre Gespenster in dem Ganzen?
Wenn man an Schottland denkt, kommen einem unweigerlich Whisky, der Dudelsackspieler im karierten Schottenrock oder das Ungeheuer von Loch Ness in den Sinn. Der Norden Großbritanniens hat jedoch weitaus mehr zu bieten als Whisky & Co. Alte Steinkreise und -formationen, mittelalterliche Burgen und Schlösser sowie historisch bedeutende Kriegsplätze: Gerade wenn es um schottische Spuk- und Geistergeschichten geht, kommen Fans des Übernatürlichen auf ihre Kosten.
Edinburgh ist bekannt für seine engen und dunklen Gassen sowie steilen Treppengänge. Kein Wunder, dass sich viele Schriftsteller*innen von dem „Gruselcharme“ haben anstecken lassen, so u.a. der Autor Robert Louis Stevenson („Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“) oder auch „Harry Potter“-Schöpferin Joanne K. Rowling. Welche Geistergeschichten kursieren denn aber nun in Schottlands Hauptstadt?
Die Geister in Edinburghs Untergrund
Da wären zum einen der sogenannte kopflose Trommler, der durch die Räume des Edinburgh Castles schleicht und dessen Trommelgeräuschen man heute noch lauschen kann. Ebenso gibt es eine Frau namens Janet Douglas, auch bekannt als Lady of Glamis, die 1537 wegen Hexerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und nun regelmäßig in der Burg umherirrt.

Die Royal Mile ist die Verbindungsstraße zwischen dem Edinburgh Castle und dem Holyrood Palace. Foto: Natalie John.
Eine weitere spannende Geschichte ist die des verschollenen Dudelsackspielers. Vor einigen Jahrhunderten entdeckte man Tunnel unter der Royal Mile, von denen man annahm, dass sie Edinburgh Castle mit dem Holyrood Palace verbinden. Um der Sache auf den Grund zu gehen, schickte man einen Dudelsackspieler in die Gänge hinunter. Dabei sollte er auf seinem Instrument spielen, um mitverfolgen zu können, wo sich der Pfeifer gerade aufhält. Auf halbem Weg zwischen der Burg und dem Palast verschwand das Dudelsackspiel jedoch plötzlich. Sofort ließ man eine Rettungsmannschaft nach dem Musiker schicken, doch er ist seither nicht mehr gesehen worden. Noch heute, heißt es allerdings, kann man sein Lied auf der Royal Mile klingen hören.
Edinburgh Castle
Hoch über der Stadt Edinburgh thront das majestätische Schloss auf einem inzwischen erloschenen Vulkanfelsen. Größtenteils gebaut im 16. Jahrhundert und seitdem immer wieder Schauplatz von Plünderungen, Zerstörungen und Wiederaufbauten ist die Burg bekannt für ihre blutige und düstere Geschichte. Die wohl bekannteste Festung Schottlands ist somit nicht nur eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Edinburghs, sondern auch einer der gruseligsten Orte Schottlands mit der wohl höchsten Geisterdichte im ganzen Umkreis!
Immer wieder versuchen Wissenschaftler*innen nachzuweisen, was viele schon lange vermuten: die Existenz von Geistern innerhalb der Burgmauern. So auch der britische Psychologe Richard Wiseman, der 2001 ein Experiment mit 240 Freiwilligen durchführte. Wie BBC News berichtete, erkundete Wiseman in einer zehntägigen Studie mit seinen Testpersonen die dunklen Kammern und Kerker des Schlosses und beobachtete deren Verhalten. So gaben die Besucher*innen anschließend zu Protokoll, dass sie unterschiedliche Anzeichen von paranormalen Aktivitäten spürten. Einige fühlten eine Berührung im Gesicht oder ein Ziehen an der Kleidung. Andere wiederum bemerkten eine plötzliche Kälte oder ein brennendes Empfinden auf der Haut. Außerdem waren manche überzeugt, Schatten und Umrisse von Menschen zu sehen, obwohl sich definitiv keine im Raum befanden. Wiseman selbst zeigte sich nach dem Experiment allerdings immer noch skeptisch. Ob sich die Geheimnisse von Edinburgh Castle jemals wirklich lüften lassen, bleibt also fraglich.
Der einsame Highlander von Culloden
Kein anderer Ort vermag wohl das Trauma der Schotten deutlicher aufzuzeigen als Culloden, ein historisch bedeutender Landfleck in der Nähe von Inverness. Das heutige Wiesenfeld bestand im 18. Jahrhundert noch aus einer trostlosen Moorlandschaft. 1746 fand dort die blutige Schlacht zwischen der Armee von Charles Edward Stuart mit seinen Clanmitgliedern und den Engländern statt.
Keine 40 Minuten dauerte die Schlacht, in der die englischen Regierungstruppen die schottischen Highlander brutal niedermetzelten. Das Ereignis markiert einen Wendepunkt in der schottischen Geschichte, leitete es doch das Ende der schottischen Clans und ihrer Kultur ein. Ein idealer Schauplatz, der nach Geistererscheinungen und unnatürlichen Ereignissen nur so schreit. Wen wundert es also, dass Besucher*innen auch heute noch überzeugt sind, Kampf- und Kriegsgeschrei, Geschützfeuer sowie marschierende Füße und Trommelschläge wahrzunehmen? Außerdem gibt es Zeug*innen, die behaupten, sie hätten einen einsamen, erschöpften Highlander gesehen, der durch die Gegend schleiche und dabei immer wieder das Wort „besiegt“ vor sich hinmurmele.
Der älteste und gruseligste Pub Schottlands
Ohne Zweifel eignen sich alte Burgen und Schlösser sowie Schauplätze von blutigen Schlachten besonders gut für Spukgeschichten. In Schottland machen Geister jedoch auch vor „normalen“ Orten keinen Halt. So gilt im ältesten und wohl gruseligsten Pub alle Vorsicht, wenn es um unerwünschte und gespensterhafte Gäste geht. Im „Drovers Inn“, einem im Jahre 1705 eröffneten Gasthaus unweit des Loch Lomond, sollen Geister regelmäßig ein und ausgehen. Auf der Website des Gasthauses heißt es da zum Beispiel, dass ein junger Viehtreiber namens Angus vor 300 Jahren kaltblütig vor dem Inn ermordet und aufgehängt wurde. Nun soll er des Nachts durch den Pub wandern und nach seinen Mördern Ausschau halten, um Rache zu verüben. Außerdem gibt es da eine junge Bauernfamilie, die im 18. Jahrhundert auf dem Weg in die Unterkunft in einen Schneesturm geriet und in der Kälte erfror. Heute soll sie immer noch durch die Zimmer schleichen. Doch nicht nur solche Geistergeschichten machen den Pub zu etwas Besonderem, auch kuriose Berichte der Gäste selbst geben Rätsel auf. So berichtete eine Besucherin, dass sie eines Morgens Bilder auf ihrer Kamera fand, die sie schlafend zeigten. Weder Gäste noch Bedienstete konnten in das Zimmer gelangen, da es von innen abgeschlossen war. Ein weiterer unerklärlicher Vorfall ereignete sich bei einer Familie, die eine Geburtstagsfeier in dem Inn feierte. Auf den aufgenommenen Bildern der Party entdeckte die Mutter einige Tage später ein kleines Mädchen in einem rosa Kleid, das sie zuvor noch nie gesehen hatte. Weder gehörte es zu der Partygesellschaft noch waren an dem Abend überhaupt irgendwelche Kinder anwesend. Selbst die Angestellten des „Drover Inn“ waren ratlos. Im Übrigen beherbergt der Pub nicht nur Geister, auch Promis wie der schottische Schauspieler Gerard Butler sollen des Öfteren hier gesichtet worden sein.
Egal, ob in den Kerkern des Edinburgh Castles, auf dem Schlachtfeld von Culloden oder im ältesten Pub Schottlands: Geister scheint es in dem Land wohl zur Genüge zu geben. Wer also mal Lust verspürt, auf Gespensterjagd zu gehen oder einen Urlaub mit Gruselfaktor sucht, dem sei Schottland wärmstens empfohlen.
Helden treffen wir überall. Ob Thor, Batman, die nette Nachbarin oder der selbstlose Unbekannte, der ein Kind vorm Ertrinken rettet. Aber ist wirklich jeder von ihnen der unnahbare Held, der er zu sein scheint? Was macht einen Helden überhaupt zu diesem und wie können wir selbst zu einem Helden werden?
Sie ist das berühmteste Gespenst Nordeuropas, gefeierter Star in mehreren Filmen und das vielleicht sympathischste Gesicht in der „Kammer des Schreckens“ – trotz ihrer dunklen Vergangenheit. Unsere Reporterin Judith Bauer traf die Maulende Myrte.
Myrtes Toilette ist kein fröhlicher Ort. Wahrscheinlich war er das noch nie: Seit Jahrzehnten vernachlässigen ihn die Hauselfen beim Putzen, von jungen Hexen wird er gemieden und der magischen Öffentlichkeit ist er vor allem deshalb bekannt, weil dort einst ein Mord geschah. Auch Myrte selbst ist eine düstere Gefährtin. Dass sie überhaupt zu einem Treffen bereit war, ist ein kleines Wunder – normalerweise reagiert sie auf Anfragen kategorisch unhöflich. Bei meinem Besuch will ich daher auch der Frage nachgehen, wieviel Inszenierung hinter dem Image der tragischen Heldin steckt und ob da nicht eigentlich immer noch die Teenagerin zu finden ist, die sie einst war. Wer ist die Maulende Myrte?
Vorbereitung auf den Geist
Ich sehe dem Treffen in Hogwarts mit einiger Nervosität entgegen. Noch nie habe ich einen Geist gesehen, geschweige denn interviewt. Meine größte Befürchtung ist, dass ich in ein Todes-Fettnäpfchen treten könnte und im Verlauf des Gesprächs vergesse, dass es sich bei ihr um eine Untote handelt. Das Thema ist zu belastet. Noch dazu weiß ich aus den Büchern und Filmen, dass Myrte von besonders sensibler Natur ist, Anspielungen auf ihr gespenstisches Dasein nimmt sie nicht locker. Oder ist das Teil des Theaters? Gerade diese Aura reizt mich: Myrte könnte mystisch und unnahbar sein, sie könnte aber auch eine gewöhnliche, egozentrische 15-Jährige sein, die zu viel Zeit hatte, sich in ihrem Selbstbezug zu suhlen. Ich wende mich daher mit großer Umsicht und in meinem besten Oxford-Englisch an die Pressestelle der Schule, mit der höflichen Bitte, den Brief an Mrs. Moaning Myrtle weiterzuleiten. Wie peinlich, dass ich ihren Nachnamen nicht kenne.
Die überraschende Zusage zum Gespräch erfolgt prompt und postalisch: Myrte macht offenbar Gebrauch von den Schuleulen. Ihre Handschrift (ist es ihre Handschrift? Wie hält sie die Feder?) ist gewöhnlich, das Schreiben konzise und undurchsichtig. Sie lädt mich zu einem kurzen Gespräch ein, ich buche sofort den Flug. Auf der Zugfahrt in Richtung Inverness wird mir klar, dass ich im Begriff bin, eine mittelgroße Berühmtheit zu treffen, von der ich praktisch nichts weiß. Internetrecherchen zu Personen des frühen 20. Jahrhunderts, die ihr Leben in magischer Isolation verbracht haben, sind meist wenig ergiebig. Ich muss mich also auf meinen journalistischen Instinkt verlassen. Doch so viele Details können schiefgehen: Was passiert beim Händeschütteln mit einem Geist? Werde ich sie überhaupt sehen können? Vielleicht durchschaut sie all meine Unsicherheiten, immerhin hat sie sehr viel Lebenserfahrung und kennt sicher viele Menschen, Zauberer zumal. Vorsichtshalber benutze ich die Toilette im Zug, auf keinen Fall möchte ich den Fauxpas begehen und in ihrer Gegenwart über derart profane Dinge sprechen, die auch noch private Erinnerungen wecken könnten.
Auf der Toilette mit Myrte
Am Schlosstor werde ich von einem unscheinbaren älteren Herrn mit Katze abgeholt. Er führt mich wortlos durch die Gänge bis zur Toilette im ersten Stock. Ich bin zu nervös, um auf die Gemälde oder Einzelheiten der Schule zu achten, am nächsten Tag fallen mir keine Details mehr zu diesem denkwürdigen Ort ein. Fotografieren ist ausdrücklich verboten. Ich nehme an, die Warner Brothers haben ihre Finger im Spiel. In der Toilette wartet Myrte auf mich. Als ich eintrete, steht sie mit dem Rücken zu mir am Fenster, am anderen Ende des Raumes. Erst als ich mich mit einem Räuspern bemerkbar mache, dreht sie sich um. Sie schwebt tatsächlich, ihre Füße scheinen den Boden nicht zu berühren. Apropos berühren – über Körperkontakt muss ich mir offsichtlich keine Gedanken machen, sie hält das ganze Gespräch über großen Abstand. Meine Nervosität verschwindet, sobald ich die ersten Sätze sage. Das hier ist letztendlich doch nur ein Interview.
Welchem glücklichen Umstand verdanke ich also die Großzügigkeit ihrer Einladung? Tatsächlich hat sie einen Artikel von mir gelesen, in dem ich über die verkannte Genialität der Erscheinungen in Emily Brontës Sturmhöhe schrieb. Offenbar identifiziert sich Myrte stark mit Cathy Earnshaw. Ich kann diese Antwort zunächst nicht einordnen – in erster Linie schmeichelt es mir sehr, mit meinen bescheidenen Schriften ein prominentes Publikum zu erreichen. Die Antwort ermutigt mich zu den forscheren Fragen auf meinem Zettel. Warum ausgerechnet diese Mädchentoilette? Unterhält sie Beziehungen zu anderen Gespenstern? Wie geht sie damit um, dass die meisten Menschen in ihrem Umfeld (bzw. alle Menschen) so viel jünger sind als sie? Erinnert sie sich an den Moment ihres Todes?
Ein Schrecken ohne Ende?
Myrte lässt sich Zeit mit ihren Antworten, immer wieder wendet sie sich beim Sprechen von mir ab oder schwebt gar durch den Raum. Selten fand ich es so schwer, einer Gesprächspartnerin zu folgen. Auch ihre Art zu sprechen bereitet mir Schwierigkeiten, so bemüht hauchig und leise, gar nicht wie im Film. Was ich über sie erfahre, ist, milde gesagt, ernüchternd. Ihr Tod sei hinreichend in den Büchern beschrieben, interessanter sei ohnehin ihr Leben danach. Mit den Jahren habe sie große Weisheit erreicht und verstehe jetzt sehr viel über menschliches Leid und die Grausamkeit der Welt. Ihr ganzes Leben hindurch habe keiner sie verstanden und auch jetzt fehle ihr die wahre Anerkennung. Harry Potter hätte ohne sie nicht einmal sein zweites Schuljahr überlebt. Überhaupt: Harry Potter! Alle ihre Antworten führen unweigerlich zu langwierigen Auslassungen darüber, wie nahe sie sich gestanden hätten. Es sei sogar mehrmals fast zu einem Kuss gekommen, doch die gesellschaftlichen Konventionen hätten ihn davon abgehalten, seinen wahren Gefühlen nachzugehen. Auf meine hoffnungsvolle Nachfrage zur aktuellen Lage der Geister-Gleichstellung geht sie überhaupt nicht ein. Stattdessen legt sie mir nahe, in meinem Text doch klarzustellen, dass ihre filmische Darstellung nicht akkurat sei. Der Darstellerin fehle die intellektuelle Tiefe für eine derart anspruchsvolle Rolle. Außerdem habe sie eine schlechte Frisur.
Über drei Stunden dauert unser Treffen. Sie spricht auch dann noch weiter, als ich resigniert aufhöre, Fragen zu stellen und mich langsam Richtung Tür bewege. Generationen von Hogwartsschülerinnen lagen nicht falsch: Die Toilette der Maulenden Myrte ist kein guter Ort.
Warum heißen solche Geschäfte eigentlich immer Haarvantagarde, spectacoolhair oder Kamm Bodscha? Sind nicht die Menschen in einem Friseursalon wichtiger als ein besonders gutes Wortspiel im Namen? Eine Glosse über haarsträubende Namen von Friseurgeschäften.
Der Traum vom eigenen Friseursalon. Der Boden ist gefegt, die schweren ledernen Drehstühle zurechtgerückt und die Kaffeemaschine im Hinterzimmer vorgeheizt. Ein letzter Blick in den Spiegel, ob die Frisur sitzt und auf den Spiegel, ob auch wirklich alles blitzeblank geputzt ist. Damit dann auch beim Bewerten der neuen Frisur nichts am eigenen Spiegelbild stört. Alles scheint bereit um den Laden zu eröffnen.
Ab jetzt werden hier über Jahre hinweg hunderte Menschen ein- und ausgehen. Mal zufriedener, mal weniger. Aber auf jeden Fall immer mit einer neuen Frisur. Vermutlich werden ganze Tonnen an abgeschnittenen Haaren auf diesem Linoleumboden fallen und mühselig vom Azubi zusammengefegt werden. Immerhin besser, als im ersten Lehrjahr nur Kaffee zu kochen. Aber eines fehlt noch: Der Name zum eigenen Traum aus Haarspraydosen und Friseurwägelchen. Wie soll das hier alles heißen? Von welchem tollen Geschäft sollen meine Kunden ihren Freunden und Bekannten erzählen? „Du musst unbedingt ins Vier-Haareszeiten, da liest dir der Friseur, wie in einem guten Hotel, jeden Wunsch von den Augen ab.“ Oder eher: „Der Pony ist zwar etwas schief, aber die im Haarbracadabra machen einen zauberhaften Kaffee.“

Wie hätten Sie’s denn gerne? (Quelle: Positive_Images, Pixabay.com)
Bei den Namen für ihre Salons scheinen Friseure meist kreativer als bei der Auswahl ihrer Zeitschriften im Lesezirkel. Aber wer möchte denn nicht gerne ins Chaarisma, weil dort die Gespräche einfacher netter sind. Oder ins Atmosphair, weil dort … naja Sie verstehen schon. Zugegebenermaßen ist es auch nicht einfach, für ein solches Geschäft einen passenden und zu gleich wohlklingenden Namen zu finden. Wie soll man das alles beschreiben, was hier so passiert? Die Oma, die sich wieder eine aufwendigere Dauerwelle machen lässt, weil sie sowieso wieder etwas mehr von ihren Enkeln zu erzählen hat. Der Punk, der hastig auf das Foto neben der Sascha Lobo Kolumne gestikuliert und zu verstehen gibt, er wolle seine Haare genauso – nur in grün. Oder ich, der sich schüchtern auf einen der Drehstühle setzt, in der Hoffnung, das geht hier alles schnell vorbei, ohne große Gesprächsversuche des behandelnden Friseurs, und einigermaßen zu meiner Zufriedenheit.
Wenn ich jetzt daran denke, wie mein Friseursalon heißt, den ich alle paar Wochen, wenn die Länge der Haare mal wieder über meinen Unmut siegt, betrete, fällt mir nichts ein. Keine Ahnung wie das Geschäft heißt. Alles, was ich weiß ist, dass der Mann dort meine Haare zu einem Knüllerpreis von acht Euro schneidet und mich dabei weitestgehend in Ruhe lässt. Währenddessen beschallt uns fragwürdiger Sprechgesang. Das alles könnte auch in einer Nachmittagstalkshow im Privatfernsehen stattfinden. „Komm rein und gehe mit anderen Haaren wieder heraus“ beschreibt wahrscheinlich am besten einen Friseursalon. Der Name ist aber zu sperrig um ihn seinen Freunden zu empfehlen. Vorhair und Nachhair kommt da am Nächsten.
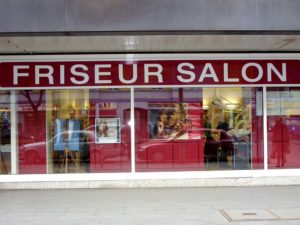
Warum nicht einfach so? (Quelle: Merker Berlin, gemeinfrei, Wikimedia Commons)
Daher haben sich über die ganze Republik verteilt, Inhaber von Friseurgeschäften ausgefallenere Namen für Ihren Lebensmittelpunkt ausgedacht: Kamm In! fordert direkt zu einem Besuch auf, erinnert gleichzeitig aber auch an den Werbeslogan einer Parfümeriekette. Bei Fönix kommen wahrscheinlich Harry Potter Fans auf ihre Kosten. Bei Pony und Clyde dagegen niemand. Im Salon Haarnarchie würde dem Punk sicherlich mit seinem Frisurenwunsch geholfen werden können. Sie merken, ich könnte stundenlang weitermachen mit Haarvantagarde, spectacoolhair oder Kamm Bodscha.
Über Kurz oder Lang – übrigens auch der Name eines Salons – bringt es aber nichts sich über diese Wortspiele aufzuregen; Denn ich habe fast Verständnis für diese armen Leute, die auf verzweifelter Suche nach einem schönen Namen sind. Eine Google-Suche bestätigt dies. Die erste Seite der Suchergebnisse ist voll von Leuten, die um Ideen für einen „coolen“ oder „verlockenden“ Namen für ihren Salon bitten. Ein Nutzer namens „funnyHamburger“ fragt nach einem Namen für einen Friseursalon mit Nagel- und Kosmetikstudio. Seine Idee „Cut & More“ sei leider patentiert, daher suche er auf diesem Wege nach einer Alternative, denn es handle sich um einen „sehr modernen trendigen Salon auf dem Kiez.“ Die Topantwort, wie sie Werner Schulze-Erdel im Familienduell anmoderieren würde, kommt vom Nutzer „DizzyD“: „Hier bei mir gibt’s nen Salon der heisst „Girls like Ponies“. Doppeldeutig, weil übersetzt: „Mädchen lieben Ponys“ sowohl für die – oftmals tatsächlich vorhandene – Vorliebe der Frauen für Pferde, als auch für die Frisur gemeint sein kann.“ Danke, DizzyD. Danke für nichts. Auch seine anderen Vorschläge „His & Hairs“ oder „Dye Hard“, stoßen zumindest bei mir auf wenig Zuspruch. Später bemerkt DizzyD in seiner Antwort völlig korrekt: „Sowieso: Wenn man Wortspiele will, muss man aufpassen, dass es nicht blöd wird.“
Vielleicht ist es aber auch ganz egal, wie das Geschäft heißt, in dem mir alle paar Wochen die lästige Mähne gekürzt wird. Vielleicht sind die Menschen in diesem Laden viel wichtiger. Vielleicht schafft es der Friseur oder die Friseurin sogar bei mir ein wohliges Gefühl auszulösen, das mich gar nicht an einen anderen Friseursalon mit kreativen Wortspielnamen denken lässt. In diesem Moment fällt mir der Name des Friseursalons der alten Dame ein, den ich als Kind immer zusammen mit meiner Mutter besucht habe: „Bei Rosie“. Daran erinnere ich mich gerne zurück, denn es gab kein Wortspiel, das mein Vorschul-Ich wahrscheinlich nicht verstanden hätte, und nach der durchgestandenen Tortur immer einen Lolli.
Wer sich weitergehend mit der Diskussion von „funnyHamburger“ und „DizzyD“ auseinandersetzen möchte, findet hier den Beitrag.
Wer wissen möchte, wo man Friseursalons mit solch kreativen Namen finden kann, klickt hier
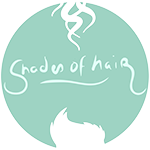


 unsplash
unsplash
 Natalie John
Natalie John



